Startseite » Newsletter » Juli 2021: Hochintensiv fokussierter Ultraschall
Hochintensiv fokussierter Ultraschall - Kommt die Alternative zur Tiefenhirnstimulation?
Artikel vom 11.07.2021
Aktuell etabliert sich womöglich eine Alternative zur Tiefenhirnstimulation. Seit 2019 wird an den Universitätsklinika zunächst in Bonn und dann in Kiel ein Verfahren erprobt, das ebenfalls unmittelbar auf das Hirngewebe zielt: der Einsatz von hochintensiv fokussiertem Ultraschall.
Bei dem Verfahren werden hochintensive Ultraschallwellen von 1024 Positionen rund um den Schädel in die Tiefen des Gehirns geschickt. Wo sie zusammentreffen, erhitzt sich das Gewebe auf etwa 55 bis 64 Grad Celsius; daher muss auch das Schädeldach des bei der Behandlung wachen Patienten gekühlt werden. Das gebündelte Aufeinandertreffen der Wellen zerstört einen etwa zwei Millimeter großen Bereich. Bislang inaktiviert man so vor allem jenes Areal im Gehirn, das für schweres, therapieresistentes „Alterszittern“ ursächlich ist. Der Erfolg lässt nun Parkinsonkranke hoffen, die häufig ebenfalls unter heftigem Zittern leiden. Allerdings hat dieser „Ruhetremor“ andere Ursachen und tritt wie alle Symptome meist in einer Körperhälfte weitaus stärker auf. Aktuell wird stets auch nur eine Kopfseite mit hochintensivem Ultraschall
behandelt.
Bislang stellten sich weltweit 3000 Menschen dem Eingriff. Die Ergebnisse sind gut, die Erfahrungen mit der neuen Methode vielversprechend. Ihr Vorteil: Der Kopf wird nicht geöffnet. Allerdings muss der Patient – vergleichbar der Tiefen Hirnstimulation – einen stereotaktischen Rahmen über mehrere Stunden am Schädelknochen angeschraubt erdulden.
„Vorteilhaft ist, dass man vor dem endgültigen Eingriff den Erfolg prüfen kann“, sagt Daniela Berg, Leiterin der Neurologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Standort Kiel. Der erhoffte Effekt lässt sich vorab bei einer Temperatur von knapp 50 Grad Celsius testen; die Inaktivierung des Gewebes am Zielort ist dann noch reversibel.
„Auch wenn noch wenig Langzeiterfahrungen vorliegen, stimmen Ergebnisse einer im April 2021 veröffentlichten britischen Studie an 40 Parkinson-Erkrankten zuversichtlich“ sagt Berg. Die motorischen Störungen besserten sich bei fast allen Patienten deutlich. Allerdings kam es bei jeweils etwa der Hälfte der Teilnehmer zu Kopfschmerzen, Schwindel, Sprechstörungen und Überbeweglichkeiten. Die Symptome verschwanden jedoch bei fast allen Betroffenen meist kurz nach dem Eingriff wieder oder hatten sich ansonsten spätestens ein halbes Jahr nach der OP gelegt. Darüber hinaus finden sich vereinzelt Berichte über vorübergehende Lähmungserscheinungen oder Patienten, die zeitweise Probleme mit der Orientierung im Raum bekamen.
Ergänzt wird das Netzwerk durch zwei weitere Bausteine: Jeder Patient erhält einen Parkinson-Lotsen, einen individuellen Ansprechpartner für alle Alltagsprobleme des Patienten. Und in Parkinson-Schulungen lernen die Patienten selbst mehr über ihre Erkrankung, und wie sie mit ihr umgehen können. Wenn PANOS erfolgreich ist, ließe sich dieses Konzept auch auf andere ländliche Regionen in Deutschland übertragen.




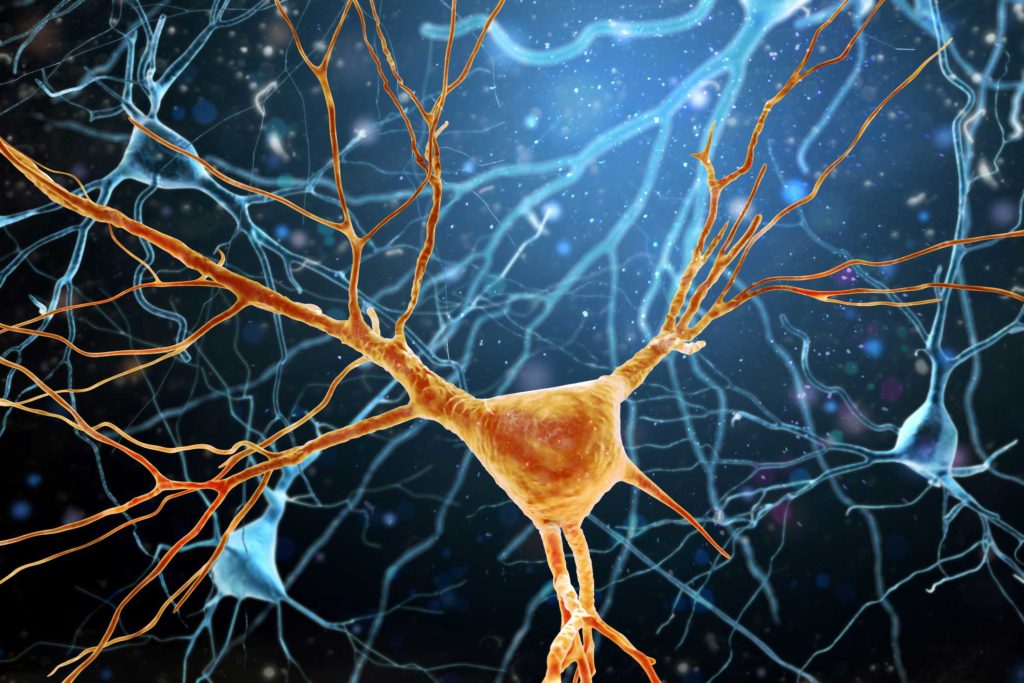
 Spenden
Spenden